Trinkgeld in der Schweiz: So wurde aus Pflicht eine Geste
Quelle: ZüriToday / Olivia Eberhardt
Das Essen hat geschmeckt, der Wein war süffig, die Bedienung freundlich. Stimmen all diese Punkte, fällt der Griff in die Kleingeldtasche des Portemonnaies deutlich leichter. Aber dann kommt die grosse Unsicherheit: Gebe ich zu wenig Trinkgeld, wirke ich geizig, gebe ich zu viel, wirke ich protzig. Doch wie viel ist denn nun zu viel und wie viel zu wenig?
Im Preis inbegriffen
Hierzu lohnt sich der Blick zurück: In den frühen 1970er-Jahren war die Lage nämlich unübersichtlich. Während gewisse Betriebe die Preise inklusive Service angaben, kam dieser bei anderen erst am Schluss dazu. Dies änderte sich 1974 mit der Einführung des Landes-Gesamtarbeitsvertrags des Gastgewerbes (L-GAV). Seither gilt das System «Service inbegriffen» für das Gastgewerbe als allgemein verbindlich.
Heisst auch: Seither muss niemand mehr Trinkgeld geben. «Dieses ist im Preis bereits inbegriffen», sagt Astrid Haida von Gastrosuisse. «Die Abgabe eines sogenannten Overtip ist eine freiwillige Angelegenheit zwischen dem Gast und dem Mitarbeitenden.» Wie man Herr und Frau Schweizer kennt, wollen sich diese aber keine Blösse geben und würden sich, ohne einen kleinen Zustupf hinterlassen zu haben, noch lange hintersinnen.
Arbeitgeber entscheidet
Dass das Trinkgeld ausschliesslich in die Tasche des bedienenden Service-Angestellten fliesst, ist allerdings nicht sicher. Der Arbeitgeber darf anhand eines Reglements bestimmen, dass das Trinkgeld unter allen Mitarbeitern aufgeteilt wird. Wie dieses Geld schlussendlich eingesetzt wird, dürfen die Angestellten selber entscheiden. «Allgemein gültige Regelungen gibt es dabei nicht», sagt Haida.
Ältere Generation am sparsamsten
Aufgeteilt wird das Trinkgeld auch in der Bar, in der Olivia aus Winterthur arbeitet. Allerdings nur unter den Mitarbeitern, die an den jeweiligen Tagen auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Die Beträge können dabei stark variieren: «Von 30 bis zu 100 Franken war schon alles dabei.» Am grosszügigsten zeige sich dabei vor allem ein Kundensegment: «Es sind klar die Leute, die selber in der Gastronomie arbeiten. Diese geben oft mehr als 10 Prozent Trinkgeld.» Am sparsamsten ist laut Jann, Barchef und Mitinhaber einer Churer Bar, die ältere Generation: «Diese mögen sich oft noch daran erinnern, dass der L-GAV eingeführt wurde. Da dieser besagt, dass das Trinkgeld bereits im Preis inbegriffen ist, sind sie eher zurückhaltend.»
Ermessenssache
Schlussendlich sollte man sich aber nicht genötigt fühlen, Trinkgeld zu geben, wenn der Service unbefriedigend war. Denn am Ende, so Astrid Haida, entscheidet der Gast selbst, ob er etwas geben möchte, und wenn ja, wie viel. «In der Praxis wird der Overtip als Geste der Wertschätzung vor allem dann gewährt, wenn damit eine besondere Aufmerksamkeit oder zusätzliche Dienstleistung anerkannt werden soll.»
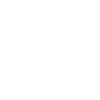
Du willst keine News mehr verpassen? Hol dir die Today-App.
(Dario Brazerol / Olivia Eberhardt)




